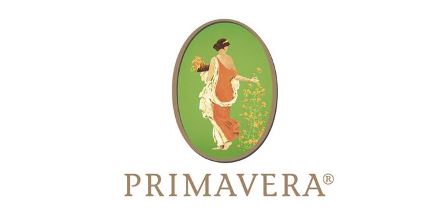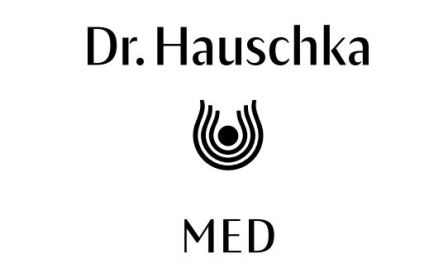21. Internationaler ÄGHE-Fastenkongress, Berlin
(vor Ort und online via zoom / Die Vorträge werden simultan auf Deutsch/Englisch übersetzt / Der Zoom-Link für die Online-Teilnahme wird allen Ticketinhabern am Samstagmorgen zugemailt)
21st International Fasting Conference of the GERMAN MEDICAL ASSOCIATION FOR FASTING AND NUTRITION in Berlin
(on-site and online via zoom / The presentations will be simultaneously translated into German/English / The Zoom link for online participation will be emailed to all ticket holders on Saturday morning)
5. / 6. Juli 2025
Kaiserin-Friedrich-Haus, Robert-Koch-Platz 7, 10115 Berlin
Wir danken den Unterstützern unseres Kongresses:
Zusammenfassung Fastenkonferenz
(deutsch)
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Fastenkonferenz zum Nachlesen. Sie können sie auch als PDF hier herunterladen:
10:30 - Sabrina Leal Garcia - Psyche, Darm und Vagus: Interdisziplinäre Perspektiven auf die Gut-Brain-Communication
Sabrina Leal Garcia thematisierte die Rolle der Darm-Hirn-Achse bei der Entstehung und Behandlung psychischer Erkrankungen, die oft mit chronischer Entzündung, verändertem Stoffwechsel und gestörter Mikrobiota einhergehen. Neuere Erkenntnisse zeigen, dass der Vagusnerv eine zentrale Schnittstelle zwischen Mikrobiom und Gehirn darstellt, und dass dieser über Ernährung, Probiotika (Psychobiotika), Fasten und Lebensstil stimuliert werden kann – was zu antientzündlichen Effekten und Besserung psychischer Erkrankungen führen kann. Eine nachhaltige Behandlung psychischer Erkrankungen erfordert demnach einen multifaktoriellen, systemischen und biopsychosozialen Ansatz, der auch Ernährung und Umweltbedingungen einbezieht.
11:00 - Mohamed Hassanein - Ramadan Fasting und Diabetes
Mohamed Hassanein betonte die Herausforderungen des Ramadan-Fastens für Menschen mit Diabetes, insbesondere hinsichtlich des Auftretens von Hypoglykämie oder Hyperglykämie. Ein neues Instrument zur Risikobewertung, ob gefastet werden sollte oder nicht, ist der als App implementierte Risk Calculator, der über 50 Faktoren berücksichtigt (z. B. Hypo-Historie, Komorbiditäten, Beruf), um personalisierte Entscheidungen und Managementpläne zu ermöglichen. Entscheidend für ein sicheres Fasten sind frühzeitige Risikoabschätzung, Patientenedukation, Anpassung der Therapie und eine strukturierte Nachsorge.
12:00 - Claudio Vernieri - Fasten in der Immuntherapie
Claudio Vernieri zeigte, dass in präklinischen Studien zyklisches Scheinfasten (fasting-mimicking diet; FMD) vielversprechende synergistische Effekte mit Immuntherapien aufweist. Während FMD Krebszellen für die Therapie sensitiviert, wird in normalen Körperzellen die Widerstandskraft verstärkt und so die medikamentösen Nebenwirkungen reduziert. Erste klinische Studien deuten darauf hin, dass FMD sicher und durchführbar bei Krebspatienten ist, die Verträglichkeit der Therapie erhöht und günstige metabolische sowie immunmodulatorische Effekte erzielt.
12:40 - Harald Sourij - Intermittierendes Fasten und Diabetes
Harald Sourij stellte Intervallfasten als vielversprechende Lebensstilmaßnahme zur Prävention und Behandlung von Typ-2-Diabetes vort – mit Evidenz für Gewichtsreduktion, HbA1c-Senkung und verringerten Insulinbedarf, sowie ohne erhöhtes Hypoglykämierisiko. Besonders wirksam zeigte sich Intervallfasten in Kombination mit Mahlzeitenersatz, wie z. B. in der Interfast-2-Studie. Die laufende Interfast-3-Studie untersucht derzeit die Kombination aus Fasten und Bewegung – Ergebnisse werden 2026 erwartet.
14:30 - Eleonore Heil - Neue DGE Empfehlungen: Spotlight Alkohol
Eleonore Heil stellte das neue DGE-Positionspapier zu Alkohol (08/2024) vor, welches den früheren Referenzwert ersetzt. Stattdessen werden erhöhte Verzehrmengen mit einem ansteigenden gesundheitlichen Risiko assoziiert (kein Alkoholverzehr = risikofrei; weniger als 27g Alkohol = risikoarm; 27g bis 81g = moderates Risiko; über 81g = extremes Risiko). Begründet wird die neue Position mit den zahlreichen gesundheitlichen, sozialen und ökologischen Folgen des Alkoholkonsums – darunter das erhöhte Risiko für mindestens sieben Krebsarten, neurokognitive Schäden, Gefahren im Straßenverkehr und Umweltbelastungen durch Produktion. Die DGE empfiehlt weiters verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen, z. B. Schutz junger Menschen, frühzeitige Intervention bei riskantem Konsum und die Förderung eines bewussten Umgangs.
15:10 - Maria Papagiannopoulou - Neues zum Fasten im Kurzformat: Mechanismen zum Ausgleich von Hypoglykämie beim Trockenfasten
Maria Papagiannopoulou stellte physiologische Anpassungen während eines fünftägigen Trockenfastens vor, darunter eine signifikante Reduktion der Blutglukose, eine gesteigerte Ketonkörperproduktion und hormonelle Veränderungen wie ein Anstieg von Cortisol und Glukagon. Gleichzeitig deuten die Daten auf eine verbesserte Gefäß- und Zellbarriere hin.
15:10 - Maria Knufinke - FastForward: A prospective analysis of long-term fasting and subsequent food reintroduction in humans
Marie Knufinke präsentierte erste Ergebnisse einer prospektiven Studie zur Aufbauphase nach Langzeitfasten. Sie zeigte, dass sich der Stoffwechsel über zwei Wochen stabilisiert und die Art der Nahrungswiedereinführung (z. B. ketogen vs. standard) entscheidend die glykämische Variabilität und metabolische Flexibilität beeinflusst.
15:30 - Michael Boschmann - Fasten, Bewegung, Stoffwechsel und Fitness
Michael Boschmann präsentierte eine Studie mit 750 adipösen Patient:innen, die ein 28-tägiges therapeutisches Fasten nach Buchinger in Kombination mit täglichem Ausdauer- und Krafttraining durchliefen. Es zeigte sich ein signifikanter Gewichtsverlust (ca. 12 kg, vorwiegend Fettmasse), ein moderater, aber funktionell gut tolerierter Proteinverlust, sowie günstige Veränderungen bei Glukose, freien Fettsäuren, Ketonkörpern und Leistungsfähigkeit. Besonders hervorzuheben ist, dass körperliches Training während des Fastens die kardiopulmonale Fitness steigert, den Stoffwechsel günstig beeinflusst und trotz Proteinverlust die Muskelkraft erhalten oder sogar verbessert werden kann.
15:45 - Robin Mesnage - The GENESIS study: MRI-based organ changes and deep phenotyping of blood and gut microbiota during prolonged fasting
Die GENESIS-Studie untersucht die Auswirkungen von 12 Tagen Langzeitfasten (250 kcal/Tag) mithilfe von Magnetresonanztomografie, Blutanalysen und Mikrobiomsequenzierung. Es wurde u. a. eine Reduktion von Lebervolumen, Leberfett und viszeralem Fett bei gleichzeitig erhaltener Muskelkraft trotz leichtem Muskelmassenverlust festgestellt. Zudem verbessert sich die Herzfunktion, die parasympathische Aktivität nimmt zu und das Mikrobiom sowie das Serum-Metabolom verändern sich signifikant. Insgesamt belegt die Studie positive systemische Anpassungen während des Fastens – einschließlich metabolischer, autonomer und mikrobieller Parameter.
16:30 - Courtney Peterson - Intermittierendes Fasten und Frauengesundheit
Courtney Peterson stellte aktuelle Studien zu verschiedenen Formen des Intervallfastens bei Frauen vor, darunter Alternate-Day-Fasting (ADF), Time-Restricted-Eating (TRE), 5:2-Diät und Fasten-mimicking-Diät (FMD). TRE zeigte bei Frauen eine moderate Gewichtsreduktion, Verbesserung der Insulinsensitivität und günstige Effekte auf Sexualhormone, unabhängig vom Menopausenstatus. Ramadan-Fasten während der Schwangerschaft wurde hingegen als potenziell schädlich eingestuft, da es mit negativen Geburtsergebnissen assoziiert ist.
17:10 - Dörte Czerner - Erfahrungen mit Heilfasten in der Gynäkologie
Dörte Czerner berichtete über die Anwendung des therapeutischen Fastens in ihrer gynäkologischen Praxis, besonders bei Frauen in der Prä-, Peri- und Postmenopause. Dabei betonte sie die Bedeutung der Zyklusphase für die Planung der Fastenzeiten sowie die individuell sehr unterschiedlichen Reaktionen, z. B. hinsichtlich Fruchtbarkeit, Gewichtsentwicklung oder klimakterischen Beschwerden. Auch in der Nachsorge gynäkologischer Krebserkrankungen (z. B. Mammakarzinom) zeigte Fasten positive Effekte auf Gelenkbeschwerden, Fatigue und Gewicht.
17:30 - Tobias Winkler, Susanne Frank, Lisa Pörtner - Interaktive Fallkonferenz: Bewegungsapparat / Schmerz “Ernährung und Fasten bei Arthrose- Quo vadis?”
Tobias Winkler (Orthopäde an der Charité), Susanne Frank (Oberärztin und Internistin mit Schwerpunkt Naturheilkunde an der Charité) und Lisa Pörtner (Ernährungsmedizinerin und Expertin für planetare Gesundheit) diskutierten den Fall einer 57-jährigen Patientin mit Adipositas und schmerzhafter Kniearthrose. Im Zentrum standen ernährungsmedizinische und naturheilkundliche Ansätze, insbesondere Heilfasten, zur Unterstützung bei chronischen Schmerzen und eingeschränkter Mobilität. Publikumsfragen und die interdisziplinäre Diskussion verdeutlichten die Bedeutung individueller Therapiekonzepte und ganzheitlicher Betreuung.
Sonntag
10:30 - Rainer Stange - Phytotherapie und Fasten – verträgt sich das?
Rainer Stange stellte Überschneidungen zwischen Fasten und Phytotherapie vor, insbesondere bei Patient:innen, die sich für integrative Heilverfahren interessieren – beide Ansätze wirken oft pleiotrop und benötigen ein Verständnis für komplexe Wechselwirkungen, z. B. bei Leber- und Nierenfunktion. Er betonte, dass Phytotherapie beim Fasten nicht nur zur Linderung von Befindlichkeitsstörungen (z. B. Schlafprobleme, PMS, Ängste), sondern auch als Ersatz für Medikamente mit ungünstigem Nebenwirkungsprofil und u.U. zur Verstärkung von Fasteneffekten eingesetzt werden kann. Studien zeigten u. a. einen Einfluss von Artischockenextrakt auf die Galleproduktion, eine Modulation des Mikrobioms durch Fasten sowie potenzielle Effekte auf die Pharmakokinetik pflanzlicher Wirkstoffe – insgesamt besteht jedoch noch viel Forschungsbedarf.
11:00 - Sepp Fegerl sen. - Fasten – Hilfestellung für danach. Wie uns der Bauch (mit der Diagnostik nach F.X. Mayr) leiten kann
Sepp Fegerl stellte die moderne F.X. Mayr-Therapie als ganzheitlichen Ansatz zur Regeneration der Darmgesundheit vor – basierend auf den vier Säulen Schonung, Säuberung, Schulung und Substitution. Der Zustand und die Lage des Darms beeinflussen maßgeblich Bauchform, Verdauungskraft und das körperliche Wohlbefinden, wobei eine gezielte Bauchbehandlung als diagnostisches und therapeutisches Werkzeug dient. Neue Daten belegen positive Effekte der Mayr-Therapie auf Autophagie, mitochondriale Funktion und DNA-Reparaturprozesse – dennoch bleiben viele physiologische Rückbildungsmechanismen (z. B. Darmatrophie) wissenschaftlich noch ungeklärt.
11:25 - Sebastian Hofer - Neue Einblicke in den Fastenstoffwechsel – von Polyaminen und Autophagie
Sebastian Hofer präsentierte neue Erkenntnisse zur Rolle von Polyaminen, insbesondere Spermidin, als zentraler Mediator der Fastenwirkung. Fasten führt in verschiedenen Spezies zu einem konzertierten Anstieg der systemischen Polyaminspiegel – dieser Effekt ist unabhängig von Alter, Geschlecht oder Gewichtsverlust. Spermidin ist notwendig für die Induktion von Autophagie und wirkt über den Polyamin-eIF5A-Signalweg – eine Unterbrechung der Polyaminsynthese (z. B. durch ODC1-Hemmung) verhindert sowohl die autophagische Antwort als auch die gesundheitsfördernden und lebensverlängernden Effekte des Fastens. Dieser Mechanismus könnte künftig zur Verbesserung der Immunfunktion bei älteren Menschen genutzt werden.
12:40 - Jost Langhorst - Lebensmittel-Unverträglichkeiten? Antworten durch die konfokale Laserendomikroskopie
Jost Langhorst zeigte, dass die konfokale Lasermikroskopie (cLE) eine zuverlässige Diagnostikmethode zur Erkennung atypischer Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei Reizdarmsyndrom (RDS) bietet, insbesondere bei Weizensensitivität und gestörter Darmbarriere. Eine multimodale integrativ-naturheilkundliche Therapie – einschließlich Ernährung, Stressregulation und Phytotherapie – führte bei 71 % der Patient:innen zur Verbesserung der Barrierefunktion, wie ein Fallbeispiel mit vollständiger Beschwerdefreiheit nach fünf Monaten belegt. Die MANTRA-Studie unterstreicht zusätzlich die Wirksamkeit und Kosteneffizienz eines multidisziplinären Behandlungsansatzes gegenüber der konventionellen Standardversorgung.
13:10 - Peter Schwarz - Ausblick für das Fasten in der Diabetologie
Peter Schwarz stellte Fasten als vielversprechendste Innovation zur weltweiten Prävention und Behandlung von Diabetes und anderen nichtübertragbaren Krankheiten vor – kostengünstig, kulturell anpassbar und mit umfassendem Wirkungspotenzial (u. a. Verbesserung der Insulinsensitivität, Reduktion von viszeralem Fett, Leber- und Pankreasfett sowie Polypharmazie). Er betonte, dass Fasten eine Remission des Diabetes erzielen kann, jedoch eine stärkere Integration in Leitlinien, mehr Evidenz und institutionelle Verankerung benötigt. Ein „Call to Action“ fordert evidenzbasierte Standards, globale Netzwerke und Bildung – damit Fasten als zugängliche, sichere und wirksame Therapieoption endlich in der Diabetologie ankommt.
Summary Fasting Conference
(english)
Here you can find a summary of the conference. Also, you can download the summary PDF here:
10:30 - Sabrina Leal Garcia - Psyche, gut and vagus: Interdisciplinary perspectives on gut-brain communication
Sabrina Leal Garcia discussed the role of the gut-brain axis in the development and treatment of mental disorders, often associated with chronic inflammation, altered metabolism, and dysbiosis. New findings highlight the vagus nerve as a key interface between the microbiome and the brain, which can be stimulated by nutrition, probiotics („psychobiotics“), fasting, and lifestyle – leading to anti-inflammatory effects and mental health improvements. Sustainable treatment requires a multifactorial, systemic, and biopsychosocial approach that includes nutrition and environmental factors.
11:00 - Mohamed Hassanein - Ramadan fasting and diabetes
Mohamed Hassanein emphasized the challenges of Ramadan fasting for people with diabetes, especially regarding hypo- or hyperglycemia. A new tool is the app-based Risk Calculator that incorporates over 50 factors (e.g., hypo history, comorbidities, profession) to enable personalized decisions and management plans. Early risk assessment, patient education, therapy adjustments, and structured follow-ups are essential for safe fasting.
12:00 - Claudio Vernieri - Fasting and immunotherapy
Claudio Vernieri presented data that fasting-mimicking diets (FMD) show promising synergistic effects with immunotherapy in preclinical studies. While FMD sensitizes cancer cells for chemotherapeutics, it enhances the tolerability in normal body cells reducing side effects. Initial clinical studies suggest that FMD is safe and feasible in cancer patients, that it increases the tolerability of the treatment, and that it offers metabolic and immunomodulatory benefits.
12:40 - Harald Sourij - Intermittent fasting and diabetes
Harald Sourij introduced intermittent fasting as a promising lifestyle intervention for the prevention and treatment of type 2 diabetes, with documented effects on weight loss, HbA1c reduction, and reduced insulin needs, without increased hypoglycemia risk. Particularly effective was the combination of intermittent fasting and meal replacement (e.g., in the INTERFAST-2 study). The ongoing INTERFAST-3 trial is currently exploring fasting in combination with physical activity, with results expected in 2026.
14:30 - Eleonore Heil - New DGE recommendations: Spotlight on alcohol
Eleonore Heil presented the new DGE position paper on alcohol consumption (08/2024), which replaces the previous reference value. Instead, increased alcohol intake is associated with an increased health risk (no alcohol intake = no risk; less than 27g alcohol = low risk; 27g to 81g = moderate risk; higher than 81g = extreme risk). This is justified by the many health, social, and environmental harms of alcohol, such as the increased risk of at least seven cancers, neurocognitive damage, road accidents, and ecological costs. The DGE recommends behavior- and policy-level prevention (e.g., youth protection, early intervention).
15:10 - Maria Papagiannopoulou - News on fasting in short format: Mechanisms to compensate for hypoglycaemia during dry fasting
Maria Papagiannopoulou presented physiological changes during five days of dry fasting, including significant blood glucose reduction, increased ketone production, and hormonal shifts (e.g., increased cortisol and glucagon). The data suggest an improvement of vascular and cellular barriers.
15:10 - Maria Knufinke - FastForward: A prospective analysis of long-term fasting and subsequent food reintroduction in humans
Maria Knufinke shared early results from a prospective study on post-fast refeeding, showing that metabolic stabilization takes about two weeks and that the refeeding type (e.g., ketogenic vs. standard diet) strongly affects glycemic variability and flexibility.
15:30 - Michael Boschmann - Fasting, exercise, metabolism and fitness
Michael Boschmann reported on a study with 750 obese patients undergoing a 28-day Buchinger fasting protocol combined with daily endurance and resistance training. Results included significant weight loss (~12 kg, mostly fat mass), moderate protein loss, and favorable changes in glucose, free fatty acids, ketones, and physical performance. Exercise during fasting improved cardiorespiratory fitness and metabolism and preserved or even increased muscle strength despite protein loss.
15:45 - Robin Mesnage - The GENESIS study: MRI-based organ changes and deep phenotyping of blood and gut microbiota during prolonged fasting
The GENESIS study investigated 12 days of prolonged fasting (250 kcal/day) using MRI, blood analysis, and microbiome sequencing. Findings included reductions in liver volume, liver and visceral fat, with preserved muscle strength despite some muscle mass loss. Heart function and parasympathetic tone improved, and both microbiome and metabolome shifted significantly – highlighting systemic benefits across metabolic, autonomic, and microbial parameters.
16:30 - Courtney Peterson - Intermittent fasting and women’s health
Courtney Peterson presented current studies on intermittent fasting methods in women, including alternate-day fasting (ADF), time-restricted eating (TRE), the 5:2 diet, and fasting-mimicking diets (FMD). TRE led to moderate weight loss, improved insulin sensitivity, and favorable effects on sex hormones, regardless of menopausal status. Ramadan fasting during pregnancy was regarded as potentially harmful due to negative birth outcomes.
17:10 - Dörte Czerner - Experiences with therapeutic fasting in gynaecology
Dörte Czerner reported on the use of therapeutic fasting in her gynecological practice, particularly for women in the pre-, peri-, and postmenopausal stages. She emphasized the importance of menstrual cycle phase in fasting planning and highlighted varied individual responses regarding fertility, weight, and menopausal symptoms. In cancer aftercare (e.g., breast cancer), fasting also showed benefits for joint pain, fatigue, and weight management.
17:30 - Tobias Winkler, Susanne Frank, Lisa Pörtner - Interactive case Conference: musculoskeletal system / pain “Nutrition and fasting for osteoarthritis – quo vadis?”
Tobias Winkler (orthopedic surgeon, Charité), Susanne Frank (senior physician and internist specializing in complementary medicine, Charité), and Lisa Pörtner (physician specialized in nutrition and expert in planetary health) presented the case of a 57-year-old obese patient with painful knee osteoarthritis. They discussed nutritional and complementary strategies – particularly fasting – to manage chronic pain and improve mobility. Audience questions and the interdisciplinary discussion highlighted the value of individualized, holistic therapy approaches.
Sunday
10:30 - Rainer Stange - Phytotherapy and fasting – are they compatible?
Rainer Stange explored overlaps between fasting and phytotherapy, especially for patients interested in complementary medicine approaches. Both methods are pleiotropic and require an understanding of complex interactions (e.g., liver and kidney function). Phytotherapy can support fasting by alleviating discomforts (e.g., sleep issues, PMS, anxiety), replacing drugs with side effects, and potentially enhancing fasting effects Studies have shown, among other things, an influence of artichoke extract on bile production, a modulation of the microbiome through fasting and potential effects on the pharmacokinetics of herbal active ingredients – but overall there is more research needed.
11:00 - Sepp Fegerl sen. - Fasting – help for afterwards. How the gut (with F.X. Mayr diagnostics) can guide us
Sepp Fegerl presented the modern F.X. Mayr therapy as a holistic gut-regeneration method based on the principles of rest, cleansing, education, and substitution. Gut shape and function affect digestion and wellbeing, with abdominal treatments serving as both diagnostic and therapeutic tools. New data show positive effects on autophagy, mitochondrial function, and DNA repair – though many physiological regression mechanisms (e.g., gut atrophy) remain poorly understood.
11:25 - Sebastian Hofer - New insights into fasting metabolism – from polyamines and autophagy
Sebastian Hofer highlighted the role of polyamines, particularly spermidine, as central mediators of fasting effects. Fasting increases systemic polyamine levels across species, independent of age, sex, or weight loss. Spermidine is necessary for autophagy induction via the polyamine-eIF5A pathway. Blocking polyamine synthesis prevents the health-promoting and life-extending effects of fasting, suggesting new therapeutic applications (e.g., improving immunity or vaccine responses in older adults).
12:40 - Jost Langhorst - Food intolerances? Answers from confocal laser endomicroscopy
Jost Langhorst demonstrated how confocal laser endomicroscopy (cLE) can diagnose atypical food intolerances in IBS, particularly wheat sensitivity and barrier dysfunction. A multimodal integrative-naturopathic approach (nutrition, stress management, phytotherapy) improved intestinal barrier function in 71% of patients – confirmed by a case of complete symptom remission after five months. The MANTRA study further supports the effectiveness and cost-efficiency of multidisciplinary treatment compared to standard care.
13:10 - Peter Schwarz - Outlook for fasting in diabetology
Peter Schwarz presented fasting as the most promising innovation for preventing and treating diabetes and non-communicable diseases globally – affordable, adaptable, and effective. Benefits include improved insulin sensitivity, reduced liver/pancreatic/visceral fat, and lower medication needs, and diabetes remission. To unlock its full potential, fasting must be better integrated into guidelines, supported by evidence, and established in clinical networks and education systems.
Zusammenfassung Symposium
(Deutsch)
Hier finden Sie eine Zusammenfassung des Symposiums zum Nachlesen. Sie können sie auch als PDF hier herunterladen:
10:35 - Prof. Schwarz - Why Fasting Guidelines Matter – Insights from the Work of the International Diabetes Federation
Prof. Schwarz hob hervor, dass Fasten eine kostengünstige, kulturkompatible und wissenschaftlich fundierte Innovation zur weltweiten Prävention von Diabetes und anderen nichtübertragbaren Erkrankungen darstellt – besonders relevant für Regionen mit hoher Krankheitslast wie Südasien. Er betonte, dass Medikamente keine echte Prävention sind, während Intervallfasten gezielt viszerales und Leberfett reduzieren kann, insbesondere durch verlängerte Ketose und Bewegung – ein vielversprechender Mechanismus für die Remission des Typ-2-Diabetes. Um die globale Herausforderung effektiv anzugehen, seien evidenzbasierte Fasten-Leitlinien nötig, die Barrieren wie ungesunde Ernährungssysteme, politische Interessen und soziale Ungleichheit adressieren.
11:15 - Prof. Hassanein - International Guidelines on Fasting and Diabetes, Work in Progress – Lessons learned from the IDF+DAR Diabetes and Ramadan Practical Guidelines
Prof. Hassanein stellte die Arbeit der IDF und der Diabetes and Ramadan (DAR) Alliance vor, die sich für ein sicheres Fasten bei Menschen mit Diabetes einsetzt – durch risikobasierte Einschätzung, gezielte Schulung und Anpassung von Ernährung, Bewegung und Medikation. Er betonte die Bedeutung eines systematischen Vorgehens zur Risikobewertung, da Hypoglykämien, Hyperglykämien und Ketoazidosen – insbesondere in den letzten Stunden des Fastentages – häufig auftreten und durch strukturierte Aufklärung vermeidbar wären. Um internationale Leitlinien weiterzuentwickeln, brauche es mehr Daten zu Fasten, Medikamentensicherheit, kulturellen Besonderheiten und den Chancen digitaler Tools – auch über den Ramadan hinaus.
12:30 - Prof. Hassanein, Prof. Schwarz, Dr. Daniela Koppold - Workshop on Fasting and Diabetes: International Guidelines Work in Progress
Im Mittelpunkt des Workshops stand ein Fall mit hohem Fasten-Risiko-Level (Score 7), bei dem durch gezielte Maßnahmen – wie Medikationseinstellung, Ernährungsschulung und Blutzuckerselbstkontrolle – das Risiko effektiv gesenkt werden konnte (Folgescore 3,5). Die vorgestellten internationalen Leitlinien betonten den Nutzen der strukturierten Risikoabschätzung vor dem Fasten (z. B. mit dem DAR Risk Score) und die Notwendigkeit individualisierter Beratung nach dem SaFa‑Prinzip (Safe Fasting). Gleichzeitig wurden Forschungslücken hervorgehoben, etwa zu evidenzbasierten Ernährungsmustern, sicherer Medikation und der Rolle von Technologie beim Fastenmanagement.
15:00 - Carolin Breinlinger, Dr. Robin Mesnage, Dr. Daniela Koppold - Short Presentation: White Paper Process – Survey on Prolonged Fasting Practices around the World
Die Präsentation stellte den internationalen „White Paper“-Prozess vor, der eine strukturierte Konsensbildung zu medizinischem Fasten ermöglichen soll – basierend auf klinischen Umfragen zu gängigen Fastenformen, Indikationen, Kontraindikationen und Begleitmaßnahmen auf drei Kontinenten. Erste Ergebnisse zeigen große Unterschiede bei Praktiken und Einschätzungen – etwa zum Einsatz von Kaffee, Kalorienzufuhr, Altersempfehlungen und Refeeding-Protokollen – während sich Indikationen wie Fettleber, Typ-2-Diabetes und Adipositas weltweit ähneln. Zentrale Forschungslücken bestehen u. a. bei Typ-1-Diabetes, Refeeding-Guidelines und der Integration ärztlicher Erfahrung in standardisierte Leitlinien, wozu ein „Call for Action“ beim Symposium aufrief.
16:45 - Dr. Claudio Vernieri - Workshop on Fasting and Oncology: Harmonization of Clinical Practice
Dr. Vernieri stellte dar, dass zyklisches Fasten und fasting mimicking diet (FMD) in präklinischen Studien das Tumorwachstum hemmen – u. a. durch reduzierte Glukoseverfügbarkeit, Senkung von Wachstumsfaktoren und Aktivierung immunologischer Mechanismen (z. B. CD8⁺-T-Zellen). Erste klinische Studien zeigen, dass Fasten begleitend zur Chemotherapie prinzipiell sicher und machbar ist, wobei die Studiendesigns bislang heterogen und oft wenig aussagekräftig sind. Offene Fragen betreffen u. a. optimale Dauer, Nährstoffzusammensetzung, Refeeding-Strategien und Kombinationsmöglichkeiten mit Immun- und Chemotherapie – hier sei internationale Koordination dringend erforderlich.
Summary Symposium
(english)
Here you can find a summary of the symposium. Also, you can download the summary PDF here:
10:35 - Prof. Schwarz - Why Fasting Guidelines Matter – Insights from the Work of the International Diabetes Federation
Prof. Schwarz emphasized that fasting is a low-cost, culturally compatible, and scientifically grounded innovation for the global prevention of diabetes and other non-communicable diseases – especially relevant in high-burden regions such as South Asia. He pointed out that medication is not true prevention, while intermittent fasting can specifically reduce visceral and liver fat, especially through prolonged ketosis and physical activity – a promising mechanism for type 2 diabetes remission. To effectively address the global challenge, evidence-based fasting guidelines are needed that tackle barriers such as unhealthy food systems, political interests, and social inequality.
11:15 - Prof. Hassanein - International Guidelines on Fasting and Diabetes, Work in Progress – Lessons learned from the IDF+DAR Diabetes and Ramadan Practical Guidelines
Prof. Hassanein presented the work of the IDF and the Diabetes and Ramadan (DAR) Alliance, which promote safe fasting for people with diabetes – through risk-based assessment, targeted education, and adjustments in nutrition, exercise, and medication. He stressed the importance of a systematic approach to risk assessment, as hypoglycemia, hyperglycemia, and ketoacidosis – especially in the final hours of fasting – are common and preventable through structured education. More data on fasting, medication safety, cultural differences, and the potential of digital tools – beyond Ramadan – are needed to further develop international guidelines.
12:30 - Prof. Hassanein, Prof. Schwarz, Dr. Daniela Koppold - Workshop on Fasting and Diabetes: International Guidelines Work in Progress
The workshop focused on a case with a high fasting risk level (score 7), where targeted interventions – such as medication adjustment, nutrition education, and blood glucose self-monitoring – effectively reduced the risk (follow-up score 3.5). The presented international guidelines highlighted the value of structured risk assessment before fasting (e.g., with the DAR Risk Score) and the necessity of individualized counseling based on the Safe Fasting Principle (SaFa). Research gaps were also identified, such as evidence-based dietary patterns, safe medication use, and the role of technology in fasting management.
15:00 - Carolin Breinlinger, Dr. Robin Mesnage, Dr. Daniela Koppold - Short Presentation: White Paper Process – Survey on Prolonged Fasting Practices around the World
The presentation introduced the international “White Paper” process, aimed at structured consensus building for medical fasting – based on clinical surveys on common fasting types, indications, contraindications, and accompanying measures across three continents. Initial results reveal major differences in practices and perspectives – e.g., regarding coffee use, caloric intake, age recommendations, and refeeding protocols – while indications such as fatty liver, type 2 diabetes, and obesity are common globally. Key research gaps include type 1 diabetes, refeeding guidelines, and the integration of medical experience into standardized guidelines, which led to a “Call for Action” at the symposium.
16:45 - Dr. Claudio Vernieri - Workshop on Fasting and Oncology: Harmonization of Clinical Practice
Dr. Vernieri presented that cyclic fasting and fasting-mimicking diets (FMD) inhibit tumor growth in preclinical studies – through mechanisms like reduced glucose availability, lower growth factor levels, and activation of immune responses (e.g., CD8⁺ T-cells). Early clinical trials indicate that fasting during chemotherapy is generally safe and feasible, though current study designs are heterogeneous and often inconclusive. Open questions include optimal fasting duration, nutrient composition, refeeding strategies, and potential combinations with immuno- and chemotherapy – calling for urgent international coordination.
Gastgebende: Prof. Dr. Andreas Michalsen, Dr. Daniela Koppold, Etienne Hanslian and Team
Abteilung Naturheilkunde im Immanuel Krankenhaus Berlin und AG klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité-Universitätsmedizin Berlin.
/ Department of Nature-Based Therapies at the Immanuel Hospital Berlin and Internal and Integrative Medicine Research Group at Charité Universitätsmedizin Berlin
Die Vorträge werden simultan auf Deutsch/Englisch übersetzt / The presentations will be simultaneously translated into German/English
.
FREITAG 4. Juli 25
16:00 – 18:00 PRECONGRESS: Mikrobiom live Workshop – Hands-on Fermentierworkshop mit wissenschaftlichem Tiefgang im Kaiserin-Friedrich-Haus (ausgebucht)
19:00 – 21:30 PRECONGRESS: „Movie and a Dinner“ – Filmvorführung der neuen ARTE Fasten-Dokumentation (Release 2025) mit anschließendem Blick hinter die Kulissen: Gespräch mit den Regisseur:innen, Einblicken in die Entstehung des Films / mit Fingerfood-Buffet (Veranstaltung ist separat zu buchen, Plätze begrenzt), Filmeinlass 19:45 Uhr
.
SAMSTAG – 5. Juli 25
09:00 Einlass / online Check-in via Zoom
10:00 Begrüßung von ÄGHE, Immanuel Krankenhaus und Charité – Rainer Matejka, Andreas Michalsen, Georg Seifert
10:20 Fasten und Ernährung aktuell– Andreas Michalsen und Daniela Koppold
10:30 Psyche, Darm und Vagus: Interdisziplinäre Perspektiven auf die Gut-Brain-Communication – Sabrina Leal Garcia
11:00 Ramadan Fasting und Diabetes – Mohamed Hassanein
11:30 Kaffeepause – parallel 1. Satellitensymposium Aurimod (11:30)
11:50 Aktive Pause (optional)
12:00 Fasten in der Immuntherapie – Claudio Vernieri
12:40 Intermittierendes Fasten und Diabetes – Harald Sourij
12:55 Aktive Pause
13:00 Mittagspause – parallel 2. Satellitensymposium Startkraft (13:00), 3. Satellitensymposium Buchinger Wilhelmi-Kliniken (13:25), 4. Satellitensymposium Ren.U (13:50)
14:30 Neue DGE Empfehlungen: Spotlight Alkohol – Eleonore Heil
15:10 Neues zum Fasten im Kurzformat: • Mechanismen zum Ausgleich von Hypoglykämie beim Trockenfasten – Maria Papagiannopoulou • FastForward: A prospective analysis of long-term fasting and subsequent food reintroduction in humans – Maria Knufinke
15:30 Fasten, Bewegung, Stoffwechsel und Fitness – Michael Boschmann
15:45 The GENESIS study: MRI-based organ changes and deep phenotyping of blood and gut microbiota during prolonged fasting – Robin Mesnage
16:00 Pause mit optionalem Yoga – 5. Satellitensymposium CellAir (16:10)
16:30 Intermittierendes Fasten und Frauengesundheit – Courtney Peterson
17:10 Erfahrungen mit Heilfasten in der Gynäkologie – Dörte Czerner
17:30 Interaktive Fallkonferenz: Bewegungsapparat / Schmerz “Ernährung und Fasten bei Arthrose- Quo vadis?” – Tobias Winkler, Susanne Frank, Lisa Pörtner
ca.18:00 Ende
19:30 Gesellschaftsabend – Netzwerken in der Hafenküche an der Spree mit Grillbuffet und einem Potpourri aus brasilianischen Tänzen (Veranstaltung ist separat zu buchen, Plätze begrenzt, Restaurant Hafenküche, zur alten Flussbadeanstalt 5, 10317 Berlin)
.
SONNTAG – 6. Juli 25
09:00 Einlass / online Check-in via Zoom
10:00 Fasten in den Religionen – ein Schauspiel (Musikalisch-spiritueller Impuls)
10:30 Phytotherapie und Fasten – verträgt sich das?– Rainer Stange
11:00 Fasten – Hilfestellung für danach. Wie uns der Bauch (mit der Diagnostik nach F.X. Mayr) leiten kann – Sepp Fegerl sen.
11:15 Aktive Pause
11:25 Neue Einblicke in den Fastenstoffwechsel – von Polyaminen und Autophagie – Sebastian Hofer
12:00 Kaffeepause – parallel 5. Satellitensymposium Primavera (12:10)
12:40 Lebensmittel-Unverträglichkeiten? Antworten durch die konfokale Laserendomikroskopie – Jost Langhorst
13:10 Ausblick für das Fasten in der Diabetologie – Peter Schwarz
13:40 Abschied inkl. Preisverleihung für das Kongressquiz
ca. 14:15 Ende
.
REFERIERENDE
Courtney Peterson, PhD, assoc. Prof. | Abteilung für Ernährung, Harvard T.H. Chan School of Public Health und Universität von Alabama in Birmingham, USA
Claudio Vernieri, Dr.med., assoc. Prof. | Labor Metabolische Reprogrammierung in soliden Tumoren, Institut für Molekulare Onkologie, Mailand, Italien
Sabrina Leal Garcia, Prof. Dr. | Klinische Abteilung für medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische Universität Graz, Österreich
Andreas Michalsen, Prof. Dr.med. | Vorstandsmitglied der ÄGHE, Abteilung Naturheilkunde, Hochschulambulanz / Immanuel Krankenhaus Berlin, Charité – Universitätsmedizin Berlin
Carolin Breinlinger | Immanuel Krankenhaus Berlin, Abteilung Naturheilkunde, Hochschulambulanz / Immanuel Krankenhaus Berlin, Charité – Universitätsmedizin Berlin
Daniela Koppold, Dr.med. | Vorstandsmitglied der ÄGHE, Abteilung Naturheilkunde, Hochschulambulanz / Immanuel Krankenhaus Berlin, Charité – Universitätsmedizin Berlin
Dörte Czerner, Dr.med. | Frauenärztin, Bergheim
Eleonore Heil, Dr. | Abteilung für Ernährungsökologie, Justus-Liebig-Universität Gießen
Georg Seifert, Prof. Dr.med. | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Charité Competence Center for Traditional and Integrative Medicine (CCCTIM)
Harald Sourij, Prof. Dr.med. | Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Medizinische Universität Graz, Österreich
Jost Langhorst, Prof. Dr.med. | Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde am Klinikum am Bruderwald, Sozialstiftung Bamberg
LisaPörtner, Dr. med. | Charité – Universitätsmedizin Berlin
Maria Papagiannopoulou |Allgemeinärztin, Athen, Griechenland
Marie Knufinke | Clinical Research Center Buchinger-Wilhelmi, Überlingen am Bodensee
Michael Boschmann, Dr.med. | Franz-Volhard Clinical Research Center, Experimental and Clinical Research Center (ECRC) Charité – Universitätsmedizin Berlin
Mohamed Hassanein, Dr. med. | Abteilung für Endokrinologie, Dubai Academic Health Association und Dubai Hospital, Dubai Health Authority, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Peter Schwarz, Prof. Dr.med. | Abteilung Prävention, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden
Rainer Matejka, Dr.med. | 1. Vorsitzender der ÄGHE, Überlingen
Rainer Stange, Dr.med. | Charité – Universitätsmedizin Berlin und Immanuel Krankenhaus Berlin
Robin Mesnage, Dr. | Clinical Research Center Buchinger-Wilhelmi, Überlingen am Bodensee
Sebastian Hofer, Dr. | Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC), Berlin
Sepp Fegerl sen., Dr. med. | Allgemeinarzt, Ernährungsmedizin, Präsident der Internationalen Gesellschaft der Mayr-Ärzte, Salzburg, Österreich
Susanne Frank | Fachärztin für Innere Medizin, Immanuel Krankenhaus Berlin
Tobias Winkler, Prof. Dr. med. | Regenerative Orthopädie und Unfallchirurgie, Charité – Universitätsmedizin Berlin
.
CME-Punkte: Der Kongress wird voraussichtlich mit 9 Punkten anerkannt (Teilnahme Samstag und Sonntag).
Das Programmheft /The programme booklet:
.
FRIDAY 4 July 25
16:00 – 18:00 PRECONGRESS: Microbiome live workshop – hands-on fermentation workshop with scientific depth in the Kaiserin-Friedrich-Haus (fully booked)
19:00 – 21:30 PRECONGRESS: “Movie and a Dinner” – Film screening of the new ARTE documentary on fasting (release 2025) followed by a look behind the scenes: Talk with the directors, insights into the making of the film / with finger food buffet (event to be booked separately, places limited) Movie admission: 7:45 PM
SATURDAY – 5 July 25
09:00 Admission / online check-in via Zoom
10:00 Welcome by ÄGHE, Immanuel Hospital and Charité – Rainer Matejka, Andreas Michalsen, Georg Seifert
10:20 Fasting and nutrition today – Andreas Michalsen and Daniela Koppold
10:30 Psyche, gut and vagus: Interdisciplinary perspectives on gut-brain communication – Sabrina Leal Garcia
11:00 Ramadan fasting and diabetes – Mohamed Hassanein
11:30 Coffee break – parallel 1st satellite symposium Aurimod (11:30)
11:50 Active break (optional)
12:00 Fasting in immunotherapy – Claudio Vernieri
12:40 Intermittent fasting and diabetes – Harald Sourij
12:55 Active break
13:00 Lunch break – parallel 2nd satellite symposium Startkraft (13:00), parallel 3rd satellite symposium Buchinger Wilhelmi clinics (13:25), parallel 4th satellite symposium Ren.U (13:50)
14:30 New DGE recommendations: Spotlight on alcohol – Eleonore Heil
15:10 News on fasting in short format: – Mechanisms to compensate for hypoglycaemia during dry fasting – Maria Papagiannopoulou – FastForward: A prospective analysis of long-term fasting and subsequent food reintroduction in humans – Marie Knufinke
15:30 Fasting, exercise, metabolism and fitness – Michael Boschmann
15:45 The GENESIS study: MRI-based organ changes and deep phenotyping of blood and gut microbiota during prolonged fasting – Robin Mesnage
16:00 Break with optional yoga – 5th satellite symposium CellAir (16:10)
16:30 Intermittent fasting and women’s health – Courtney Peterson
17:10 Experiences with therapeutic fasting in gynaecology – Dörte Czerner
17:30 Interactive case conference: musculoskeletal system / pain ‘Nutrition and fasting for osteoarthritis – quo vadis?’ – Tobias Winkler, Susanne Frank, Lisa Pörtner
19:30 Social evening – networking in the Hafenküche on the Spree with a barbecue buffet and a potpourri of Brazilian dances (event to be booked separately, places limited, Restaurant Hafenküche, zur alten Flussbadeanstalt 5, 10317 Berlin)
SUNDAY – 6 July 25
09:00 Admission / online check-in via Zoom
10:00 Fasting in the religions – a play (musical-spiritual impulse)
10:30 Phytotherapy and fasting – are they compatible? – Rainer Stange
11:00 Fasting – help for afterwards. How the gut (with F.X. Mayr diagnostics) can guide us – Sepp Fegerl sen.
11:15 Active break
11:25 New insights into fasting metabolism – from polyamines and autophagy – Sebastian Hofer
12:00 Coffee break – parallel 5th satellite symposium Primavera (12:10)
12:40 Food intolerances? Answers from confocal laser endomicroscopy – Jost Langhorst
13:10 Outlook for fasting in diabetology – Peter Schwarz
13:40 Farewell incl. award ceremony for the congress quiz
approx. 14:15 End
.
SPEAKERS
Courtney Peterson, PhD, assoc. Prof. | Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health and University of Alabama at Birmingham, USA
Claudio Vernieri, MD, assoc. Prof. | Laboratory Metabolic Reprogramming in Solid Tumours, Institute of Molecular Oncology, Milan, Italy
Sabrina Leal Garcia, Prof. Dr. | Clinical Department of Medical Psychology, Psychosomatics and Psychotherapy, Medical University of Graz, Austria
Andreas Michalsen, Prof. MD | Board member of ÄGHE, Department of Naturopathy, University Outpatient Clinic / Immanuel Hospital Berlin, Charité – Universitätsmedizin Berlin
Carolin Breinlinger | Department of Naturopathy, University Outpatient Clinic / Immanuel Hospital Berlin, Charité – Universitätsmedizin Berlin
Dörte Czerner, MD | Gynecologist, Bergheim
Eleonore Heil, Dr. | Department for Nutritional ecology, Justus-Liebig-Universität Gießen
Daniela Koppold, MD | Board member of ÄGHE, Department of Naturopathy, University Outpatient Clinic / Immanuel Hospital Berlin, Charité – Universitätsmedizin Berlin
Rainer Matejka, MD | 1st Chairman of ÄGHE, Überlingen
Georg Seifert, Prof. MD | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Charité Competence Center for Traditional and Integrative Medicine (CCCTIM)
Harald Sourij, Prof. MD | Clinical Department of Endocrinology and Diabetology, Medical University of Graz, Austria
Jost Langhorst, Prof. MD | Clinic for Integrative Medicine and Naturopathy, Klinikum am Bruderwald, Sozialstiftung Bamberg
Lisa Pörtner, MD | Charité – Universitätsmedizin Berlin
Maria Papagiannopoulou | General practitioner, Athens, Greece
Marie Knufinke | Clinical Research Centre Buchinger-Wilhelmi, Überlingen on Lake Constance
Michael Boschmann, MD | Franz-Volhard Clinical Research Center, Experimental and Clinical Research Center (ECRC) Charité – Universitätsmedizin Berlin
Mohamed Hassanein, MD| Department of Endocrinology, Dubai Academic Health Association and Dubai Hospital, Dubai Health Authority, Dubai, United Arab Emirates
Peter Schwarz, Prof MD | Department of Prevention, University Hospital Carl Gustav Carus at the Technical University of Dresden
Rainer Stange, MD | Charité – Universitätsmedizin Berlin and Immanuel Hospital Berlin
Robin Mesnage, Dr. | Clinical Research Centre Buchinger-Wilhelmi, Überlingen on Lake Constance
Sebastian Hofer, Dr. | Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC), Berlin
Sepp Fegerl senior, MD | General practitioner, nutritional medicine, President of the International Society of Mayr Physicians, Salzburg, Austria
Susanne Frank | Internal Medicine, Immanuel Krankenhaus Berlin
Tobias Winkler, Prof. MD | Regenerative Orthopaedics and Trauma Surgery, Charité – Universitätsmedizin Berlin
.
https://aerztegesellschaft-heilfasten.de/berlin-2025-ticketliste/